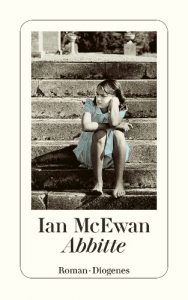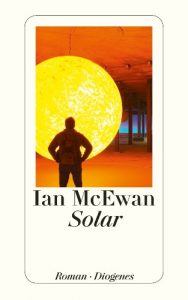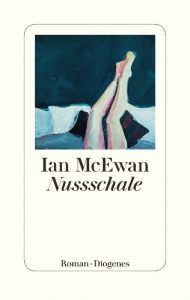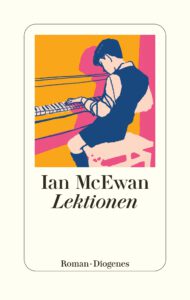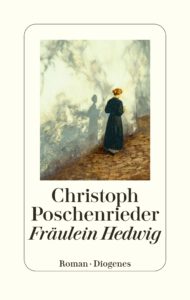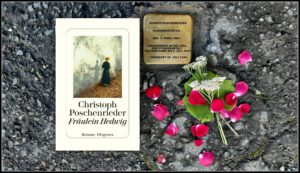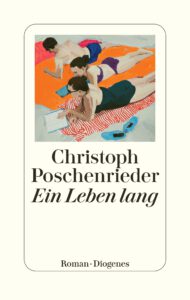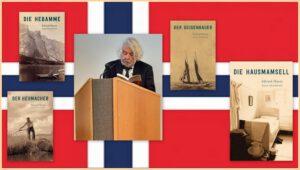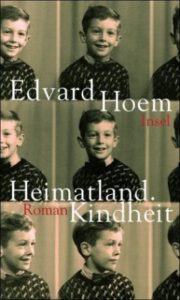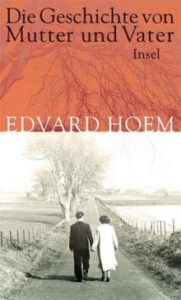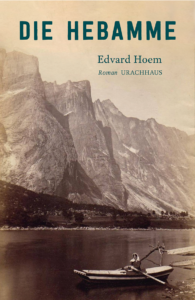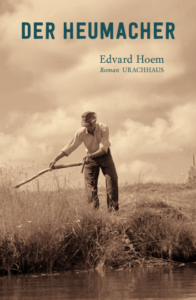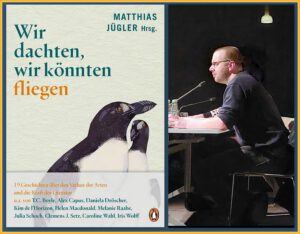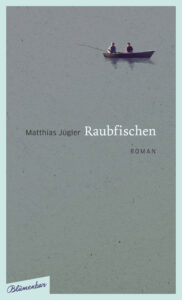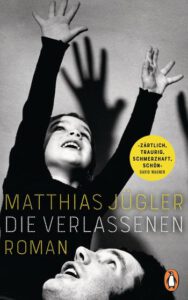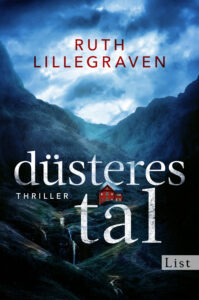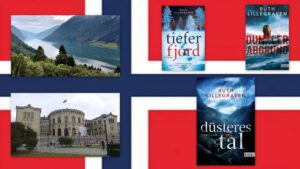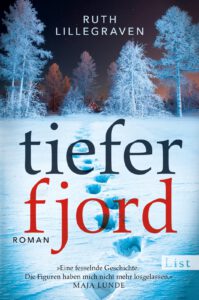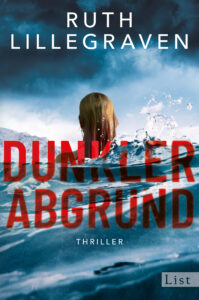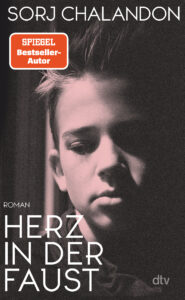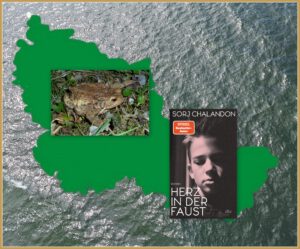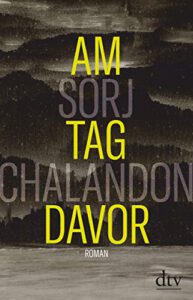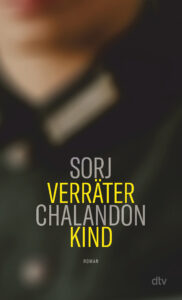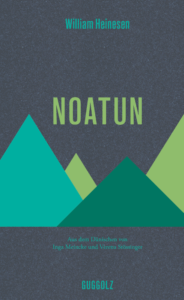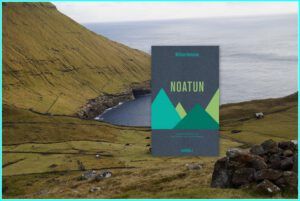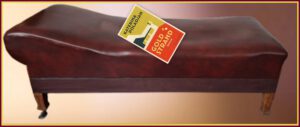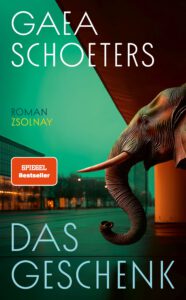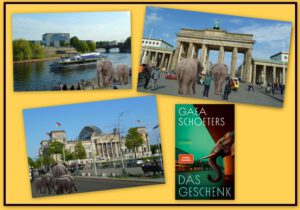Sein und Schein
Sein und Schein

Der 1948 geborene britische Autor Ian McEwan blickt in seinem Roman Was wir wissen können weit in die Zukunft: ins Jahr 2119. Es ist kein hoffnungsvolles Bild, das er im ersten Teil wie nebenbei einflicht. Aufgrund eines Tsunamis 2042 durch eine fehlgeleitete russische Interkontinentalrakete wurde Großbritannien zum Archipel, alle wissenschaftlichen Einrichtungen liegen auf Hügeln, Städte wie Glasgow oder New York verschwanden. Deutschland wurde dem russischen Großreich einverleibt, in Amerika herrschen Warlords und Nigeria ist die führende IT-Nation. Die Menschheit schrumpfte durch begrenzte, KI-ausgelöste Atomkriege, Hungersnöte und Pandemien von neun auf vier Milliarden mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 62 Jahren und drei Viertel der Arten sind ausgestorben. Unter diesen veränderten Bedingungen, mit denen die Welt von 100 Jahren zuvor paradiesisch anmutet, hat sich ein stabiles Gleichgewicht eingestellt:
In unserer Zeit sind wir daran gewöhnt, dass sich über Generationen hinweg nicht viel ändert. (S. 165)

Ein verschollener Sonettenkranz
Einer von denen, die gelassen mit den veränderten Lebensbedingungen umgehen, ist der Literaturwissenschaftler Tom Metcalfe. Sein Spezialgebiet ist die englische Literatur von 1990 bis 2030, seine Obsession ein verschollener Sonettenkranz des Dichters Francis Blundy (1950 – 2017), den dieser 2014 während eines legendären Abendessens zum 54. Geburtstag seiner Frau Vivien im Freundeskreis vortrug. Obwohl das Reisen zum Archiv mit dem Nachlass von Francis Blundy und den Tagebüchern von Vivien beschwerlich ist, trägt Tom immer mehr Material über das geheimnisvolle Gedicht zusammen, bis ihn die Last seiner Quellen fast erdrückt. Aufgrund Abertausender digitaler Nachrichten von Francis und Vivien Blundy, Surfgewohnheiten, Tagebüchern, Briefen und anderer Dokumente glaubt sich Tom befähigt, Lücken mit fundiert begründeten Annahmen zu füllen. Doch der Inhalt des Sonettenkranzes selbst bleibt ein Nährboden für Spekulationen:
Es ging nicht mehr allein um ein verschollenes, nach dem Abendessen vorgetragenes Gedicht, sondern um das, was aus diesem Gedicht dank seiner Nichtexistenz geworden war: ein Reservoir an Träumen, überbeanspruchte Nostalgie, nutzlose retrospektive Wut und Brennpunkt haltloser Verehrung. (S. 24)
Perspektivwechsel
Im 2. Teil des Romans wechselt die Ich-Perspektive von Tom Metcalfe zu Vivien und ihrer 2020 verfassten schriftlichen Beichte, die in überraschendem Kontrast zu ihren Tagebüchern steht:
Fast unmerklich wurden meine Tagebucheinträge zum Bericht meines besseren Selbst. Ich hätte es abgestritten, aber mit der Zeit hörten die Einträge auf, privat zu sein. Ich hatte einen Leser im Sinn. (S. 371)
Einen Leser wie den gutgläubigen, ein wenig in sie verliebten Nostalgiker Tom…
Wahrheit und Lüge, Schuld und Moral
Der Romantitel ist doppeldeutig: Was hätte man 2014 über zukünftige Katastrophen wissen können und auf welche Quellen ist Verlass, eine Frage, die angesichts zunehmender Bedeutung von KI immer drängender wird. Das raffinierte Spiel um Wahrheit und Lüge, Schuld und Moral, stand für mich daher im Mittelpunkt, garniert mit bisweilen satirisch angehauchten Elementen aus den Genres Krimi, Dystopie, Climate Fiction, Campus- und Eheroman, gewohnt brillant geschrieben und von Bernhard Robben hervorragend übersetzt.
Was wir wissen können ist ein Roman, der für mich mit dem Abstand einiger Tage immer mehr gewinnt, nachdem ich mich im ersten Teil streckenweise langweilte, einerseits, weil ich kein Fan von Science-Fiction-Szenarien bin, andererseits wegen thematischer und personeller Überfrachtung. Viel zu viele interessante Themen werden in unbefriedigender Kürze angerissen und geniale Ideen stehen in scharfem Kontrast zu langatmigen Details. Teil zwei war dann zwar weniger originell, dafür aber flüssiger zu lesen und überraschender in seinen Wendungen. Die kluge Gesamtkonstruktion versteht man erst auf den letzten der 462 Seiten und begreift spätestens dann, dass sich das Durchhalten unbedingt gelohnt hat.
Ian McEwan: Was wir wissen können. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes 2025
www.diogenes.ch
Weitere Rezensionen zu Romanen von Ian McEwan auf diesem Blog: